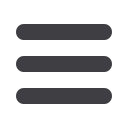
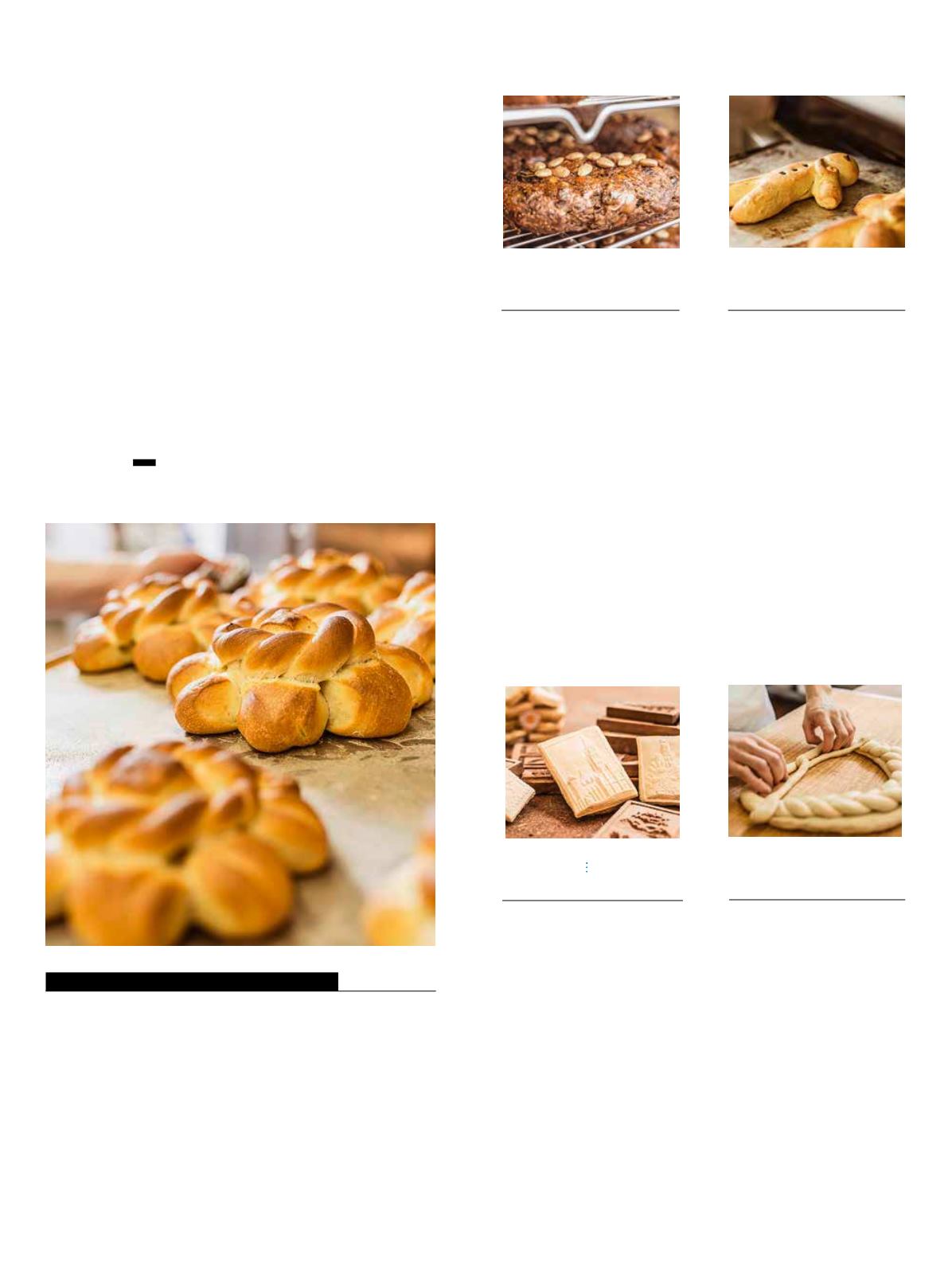
W
enn es imWinter kalt und ungemütlich ist, schmecken
uns gebackene Leckereien besonders gut. Der Duft nach
Anis, Zimt undNelken erfüllt beimBacken das ganzeHaus
und verströmt Behaglichkeit. ImSüdwesten gibt es in der Vorweih-
nachtszeit einige besondere Spezialitäten, die auf keinemBackblech
fehlen dürfen.
Hutzelbrot verdankt seinen Na-
men den verarbeiteten Früch-
ten, die neben Mehl, Nüssen
und Mandeln den Teig ergeben:
„Hutzelig“ ist schwäbisch und
bedeutet so viel wie „runzelig“.
Ursprünglich war Hutzelbrot
ein bäuerliches Festtagsgebäck.
Ein kleines Stück bekamen so-
gar die Nutztiere zu fressen, um
Unheil abzuwenden. Verfeinert
wird der Teig je nach Familien-
tradition und Geschmack mit
weihnachtlichen Gewürzen,
Rübensirup, Kirschwasser oder
Zitronat und Orangeat. Hutzel-
brot schmeckt lecker klassisch
mit Butter bestrichen oder, wer
es süßer mag, auch mit Honig
oder Marmelade.
FRÜCHTE IN
HÜLLE UND FÜLLE
Er ist in vielen Regionen zu
Hause und stellt sich stets
unter anderem Namen vor: der
Dambedei. Der aus Hefe-
teig geformte Zeitgenosse
kommt mit Rosinenaugen
und Knopfleiste aus Nüssen
daher und heißt mal Weck-,
mal Klausen-, Grätti- oder
Baselmann. Dass er häufig am
Nikolaustag gereicht wird, liegt
in der kirchlichen Tradition be-
gründet: Damals erhielten vom
Gottesdienst Ausgeschlossene
gesegnetes Brot. Am Gedenk-
tag des Bischofs Nikolaus von
Myra hatte es die Form eines
Mannes.
EIN MANN MIT
VIELEN NAMEN
Ist die Weihnachtszeit vorüber,
erfreut man sich im Süden
einer ganz besonderen Brezel:
Die Neujahrsbrezel ist meist
aus Hefeteig gefertigt und wird
mal süß, mal salzig traditio-
nell beim Neujahrsfrühstück
genossen. Dekor und Größe
unterscheiden sich stark – ein
besonders großes Exemplar
kann bis zu einem Meter mes-
sen und mehrere Kilo wiegen.
Die Form ist aus einem Neu-
jahrsring entstanden und steht
bis heute für Unendlichkeit
sowie Glück im neuen Jahr.
TRADITION ZUM
JAHRESWECHSEL
Ihr intensiver Anisgeschmack
macht sie zu einem einzigartigen
Adventsgebäck. So hübsch die
vor allem im schwäbisch-alleman-
nischen Raum verbreiteten Plätz-
chen anzusehen sind, so besonders
ist auch ihre Herstellung: Der Teig
wird in meist hölzerne Formen
gepresst, in die ein Bild geschnitzt
wurde. Mit etwas Zeit, Geduld
und Fingerspitzengefühl entsteht
beim Backen, wenn die Springerle
wortwörtlich „aufspringen“, ein re-
liefartiges Bild. Springerle sind ein
Hingucker auf jedem Plätzchentel-
ler oder am Weihnachtsbaum.
GEBACKENE
KUNSTWERKE
Es ranken sich viele Sagen da-
rum, wo und wann die Reutlinger
Mutschel entstanden ist. Man-
che sagen, sie sei ein Opferbrot.
Andere wiederum sehen in dem
traditionell aus acht Zacken
bestehenden Hefegebäck eine
Nachbildung des Sterns der
Weisen aus dem Morgenland.
Und hat wirklich der Reutlinger
Bäcker Albrecht Mutschler
das Brot im 13. Jahrhundert
erfunden? Das Wort „Mutsche“
jedenfalls stammt aus dem Mit-
telalter und bedeutet „kleines
Brot“. Heute noch feiert man am
Donnerstag nach Dreikönig in
Reutlingen „Mutscheltag“. Ur-
sprünglich fand ein Preisschie-
ßen mit Mutscheln als Siegprä-
mie statt. Heute geht es ruhiger
zu – mit einem Würfelspiel.
EIN SAGENUMWOBENES GEBÄCK
Fotos: © Corinna Spitzbarth
14
SPRINGERLE,
LEBEN
HUTZELBROT
UND DAMBEDEI
















